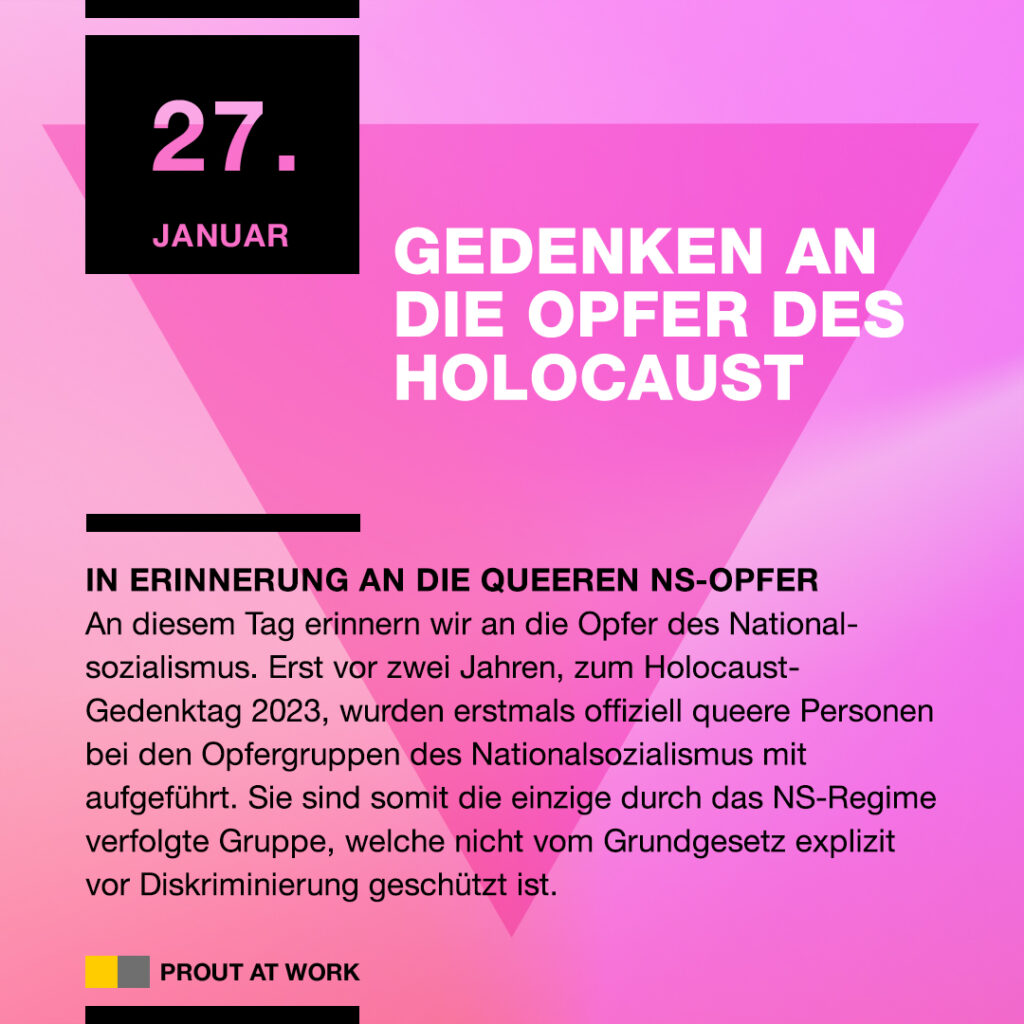
Der 27. Januar ist Welt-Holocaust-Gedenktag.
Wir gedenken an diesem Tag jährlich seit 2006 der Opfer des nationalsozialistischen Regimes. An diesem Datum erfolgte im Januar 1945 die Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau.
In der tödlichen Ideologie der Nazis gab es keinen Platz für Menschen, die sich dieser nicht widerstandslos ergaben und sich in die Einheitsgesellschaft eingliedern wollten oder konnten. Sie wurden konsequent und systematisch verfolgt, inhaftiert, in Konzentrationslager deportiert und massenhaft ermordet. Die detaillierte Organisation der Völkermorde an den europäischen Jüd_innen (die Shoah) und den Sintize und Romnja (der Porajmos) war ein bis zu dem Zeitpunkt beispielloser Zivilisationsbruch – eine Zäsur in der Geschichtsschreibung.
Zu den Verfolgten im Nationalsozialismus zählten auch queere Menschen. Genau wie andere Opfergruppen wurden sie von den Nazis inhaftiert und (in Konzentrationslagern) ermordet. In rund 100.000 Verfahren wurden während der NS-Zeit geschätzt 78.000 schwule und bisexuelle Männer ermittelt, 53.000 wurden zwischen 1933 und 1945 verurteilt und zwischen 10.000 und 15.000 wurden in Konzentrationslager deportiert. Einmal dort angekommen, überlebte nur knapp die Hälfte dieser Männer ihre Inhaftierung dort.
Lesbischen Frauen wurde keine sexuelle Selbstbestimmung zugesprochen – sie wurden hingegen als „Asoziale“ verfolgt und inhaftiert. Trans* Personen wurden angesichts ähnlich wahrgenommener Nonkonformität meist ebenfalls als unter diesen Gesichtspunkten angeklagt; aufgrund der minimalen Sichtbarkeit und mangelnder Terminologie von trans* Themen bis vor wenigen Jahrzehnten stehen dazu jedoch kaum aussagekräftige Daten zur Verfügung.
Die allgemeine Dunkelziffer, wie viele queere Personen Opfer des NS wurden, ist ähnlich hoch: Zum einen liegt die Vermutung nahe, dass auch zivile Hassgewalt eine Rolle in der Verfolgung queerer Personen spielte, zum anderen war queere Existenz auch nach der NS-Zeit ein Tabuthema.
Dieser Effekt wurde dadurch befeuert, dass auch von Seiten der Alliierten nach 1945 kein Interesse bestand, sich für die Emanzipation queerer Menschen einzusetzen. So wurde zum Beispiel der Paragraf 175, der die Verfolgung und Inhaftierung homosexueller Menschen nicht nur im Nationalsozialismus legitimierte, sondern bereits im Kaiserreich seinen Ursprung hatte, nach Kriegsende von der Bundesrepublik weiter übernommen. In der BRD und der DDR wurden Homosexuelle auf dieser Grundlage weiterhin unterdrückt, bis der Paragraf 175 im wiedervereinigten Deutschland 1994 final gestrichen wurde. Im Zuge dieser Tatsachen hinkt auch die Forschung über queere Opfer des NS sowie die damit einhergehende Berichterstattung dazu den anderen Opfergruppen weitgehend hinterher, wodurch auch 80 Jahre nach Ende des NS-Regimes vielen nicht bewusst ist, dass auch homosexuelle und trans* Menschen in Konzentrationslagern systematisch ermordet wurden. 2023 machte der Deutsche Bundestag bei der Gedenkstunde am 27. Januar zum ersten Mal offiziell auf das Leid queerer Opfer des Nationalsozialismus aufmerksam. Als Stiftung, die sich für die Chancengleichheit queerer Menschen am Arbeitsplatz und deren Rechte einsetzt, haben wir dieses Novum begrüßt, denn der Kampf um queere Rechte ist noch lange nicht abgeschlossen.
Mehr Informationen zur Situation queerer Menschen im NS.
Kritische Massen bewegen
Lassen Sie uns gemeinsam aktiv werden und queere Themen vorantreiben.
